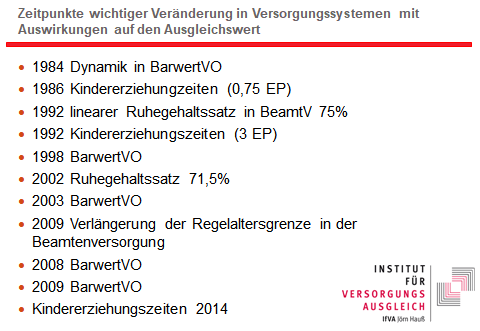Die Neufassung der Düsseldorfer Tabelle zum 1.1.2018 wirbelt immer noch Staub auf.[1] Die theoretische Aufregung über das Schicksal der Kinder, die unerwartet weniger Unterhalt als zuvor erhalten, ist groß, die praktische nicht. Die Gerichte melden keine Abänderungsanträge und die Sozial- und Gesundheitsbehörden keine kindliche Hungersnot. Gleichwohl werden Beiträge publiziert, deren Zahlendichte die Wortdichte fast übersteigt und die ahnen lassen, welch sprachzerstörende Wirkung Empörung haben kann.
Es lohnt sich, anlässlich der Neufassung der Düsseldorfer Tabelle über ihren Sinn zu reflektieren. Sie dient der erleichterten Ermittlung des ‚angemessenen Barbedarfs‘ eines unterhaltsbedürftigen Kindes. Ihre Umstrukturierung und die Neubemessung der Einkommensstufen war offenbar für viele überraschend. Die Tabelle leitet aus dem Einkommen eines Elternteils einen angemessenen Bedarf des Kindes ab. Allerdings muss nicht nur dieses angemessen alimentiert werden, sondern auch der Alimentierer. Dessen ökonomisches Siechtum löst aber nicht den Kinderschutzreflex aus, weil das ihm verbleibende Nettoeinkommen nicht augenfällig einer Tabelle entnommen werden kann, sondern errechnet werden muss.
Allüberall wird konstatiert, die Tabelle binde nicht. Wozu dann der Lärm? Ist der tabellarische Unterhalt für ein 10 Jahre altes Kind bei einem Elterneinkommen von 2.500 € in Höhe von 459 €[2] unangemessen und wäre ein Betrag in Höhe von 472 €[3] angemessener? Gibt es überhaupt eine Steigerungsform von ‚angemessen‘? Der Duden verneint das, die Logik auch.[4] Und welche Empörung wird erst einmal die Kindergelderhöhung zum 1.7.2019 um 10 € und Anfang 2021 um 15 € auslösen?[5] Da nimmt ‚die Tabelle‘ dem schutzbedürftigen Kind zum 1.1.2018 2,8 % seines Barbedarfs weg und schon bald wird der zahlende Elternteil infolge der hälftigen Kindergeldanrechnung schon wieder um 1,4 % entlastet. Gut nur, dass der Mindestbedarf des Kindes zum 1.1.2019 – was schon jetzt sicher ist – um 1,8 % heraufgesetzt wird.[6] Die Tabellenänderung zum 1.1.2019 ist schon gebucht.
Der ‚Fahrplan‘ für Eltern und Kinder lautet daher für den obigen Fall:
- Abänderungsantrag am 1.1.2018 von 375 € auf (459 € – 97 € =) 362 €
- Abänderungsantrag am 1.1.2019 von 362 € auf 369 €
- Abänderungsantrag am 1.7.2019 von 369 € auf 364 €
- Betreuungsantrag am 1.8.2019 von Amts wegen nach Eingang des letztgenannten Abänderungsantrags für Eltern, Kinder und Anwältinnen und Anwälte, die das begleiten.
Nachfragen bei Gerichten haben ergeben, dass die Änderung der Düsseldorfer Tabelle so gut wie keine Änderungsanträge verursacht hat. Auch die barunterhaltspflichtigen Elternteile wissen nämlich um die ökonomischen Bedürfnisse ihrer Kinder und die deutliche Ausweitung des Anwendungsbereichs der ersten Einkommensstufe hat die Luft gegeben, ‚Fünfe gerade sein zu lassen‘. Das gilt auch für die Staffelung der Einkommensstufen. Die recht grobe Rasterung in 400-Euro-Schritte erspart uns in der Praxis die kleinliche Auseinandersetzung um Berücksichtigung von Kosten der Kinderbetreuung in den Zeiten, in denen das Kind vom barunterhaltspflichtigen Elternteil betreut wird, und die buchhalterische Berücksichtigung anderer Bagatellbeträge. Die Grobrasterung der Einkommensstufen wirkt, wie § 18 VersAusglG wirken sollte: Die kleinkarierte ‚Wut über den verlorenen Groschen‘ ist sinnlos und kann deswegen ausbleiben. Auch barunterhaltspflichtige Eltern streiten nur selten außerhalb des Mangelfalls um Groschen. Die öffentliche Aufregung um die aus der Anhebung der Einkommensgrenzen resultierenden teilweise geringeren Zahlbeträge gedeiht auch deswegen so prächtig, weil der Kindesunterhalt oft immer noch als Strafe für die Trennung begriffen wird. ‚Dann soll er (nur selten sie) wenigstens ordentlich zahlen.‘
Der neue Zuschnitt der Düsseldorfer Tabelle war notwendig, weil eine Tabelle, die auf den Barbedarf zweier unterhaltsbedürftiger Kinder zugeschnitten ist (die Umstellung auf nur ein Kind bei unveränderten Einkommensstufen, ist von den Oberlandesgerichten abgelehnt worden), diesen in der ersten Einkommensstufe auch mangelfallfrei befriedigen muss. Die Veränderungen in der Altersgruppe 4 waren erforderlich, weil deren Mindestbedarf deutlich oberhalb des Existenzminimums lag.[7]
Man mag beklagen, dass die Berechnung des Kindesunterhalts nicht mehr ganz so computerkonform erfolgen kann und in geeigneten Fällen von den Bedarfssätzen der Düsseldorfer Tabelle abgewichen werden muss. Das ist sicher nicht strafbar. Der fach-literarische Zahlensalat, der um die neue Düsseldorfer Tabelle betrieben wird, lenkt davon ab, dass die Bestimmung des angemessenen Unterhalts JurJob[8] und nicht JurTech ist.
[1] Schürmann, Düsseldorfer Tabelle 2018, FamRB 2018, 32; Borth, Die neue Düsseldorfer Tabelle in der Kritik, FamRZ 2018, 407; Schwamb, Die Düsseldorfer Tabelle 2018 – eine bittere Pille für Kinder Alleinerziehender, FamRB 2018, 67; Wohlgemuth, Veränderung der Düsseldorfer Tabelle zum 1.1.2018 – kein großer Wurf, FamRZ 2018, 405; Viefhues, Weniger Kindesunterhalt ab 01.01.2018, FuR 2018, 20.
[2] Einkommensstufe 4 DDorfer Tabelle 2018 wegen einer geringeren Zahl unterhaltsberechtigter Personen.
[3] Einkommensgruppe 5 DDorfer Tabelle 2017.
[4] Angeklagter ist ja schließlich auch nicht die Steigerungsform von angeklagt.
[5] Koalitionsvertrag 2018 Rz. 696.
[6] Die Erhöhung des Bedarfs der ersten Einkommensstufe zum 1.1.2019 auf 353, 406 und 475 € ist bereits jetzt sicher.
[7] Und auch jetzt noch liegt.
[8] Phonetisch: Your Job.