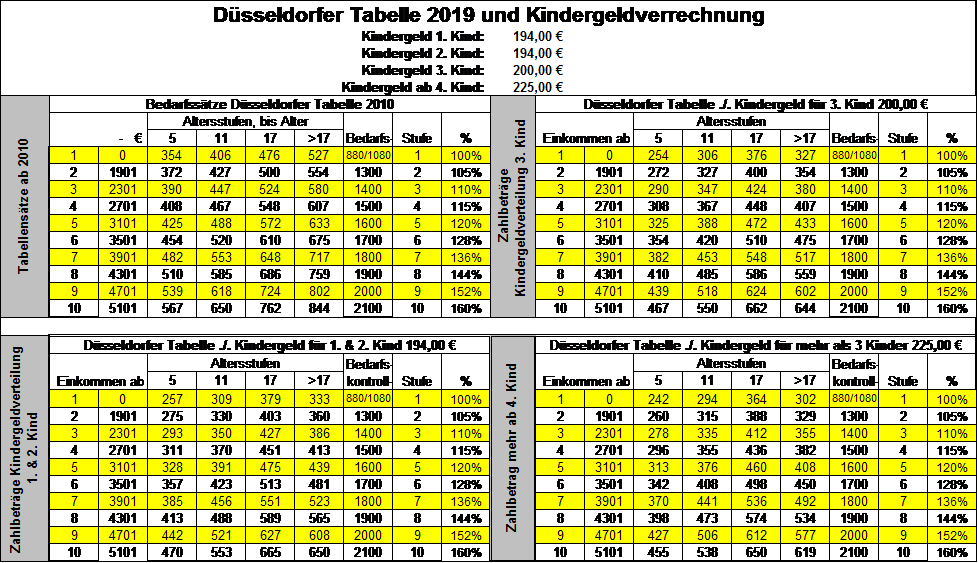„Alle Jahre wieder“ eine neue Düsseldorfer Tabelle; Heinrich Schürmann beschreibt es im Blog und in FamRB 2023, 34 zutreffend, weshalb das inzwischen erforderlich ist, und auch seiner Einschätzung, dass angesichts der fälligen Erhöhung der Selbstbehalte und der gleichzeitigen deutlichen Erhöhung der Bedarfsbeträge in der nochmals geänderten MindestunterhaltsVO 2023 eine Ausrichtung der Tabelle auf nur noch einen Berechtigten dieses Mal angezeigt gewesen wäre (anders als bei der Entnahme einer Einkommensgruppe vor 5 Jahren, vgl. damals kritisch Schwamb FamRB 2018, 67), kann ich folgen, denn der Abstand zwischen den Selbstbehalten und der zweiten Altersstufe ist nun so gering, dass eine Aufstufung bei nur einer unterhaltsberechtigten Person praktisch nicht mehr in Frage kommt.
Kritikwürdig sind und bleiben dagegen Schürmanns Ausführungen zur Bedarfssituation beim Kindesunterhalt in allen vier Altersstufen, insbesondere der von ihm weiterhin abgelehnten vierten, über deren Erhalt in vermindertem Abstand zur dritten Altersstufe jedoch ein in der Kommission mehrheitlich getragener Kompromiss vor drei Jahren zustande gekommen ist. Die Differenz liegt darin, dass Schürmann – insoweit abweichend von der gesetzlichen Regelung und auch der Rechtsprechung des BGH – eine vollständige Übereinstimmung mit der sozialhilferechtlichen Lage herstellen will. Gemeinsam ist beiden Rechtsgebieten aber nur der Ausgangspunkt des steuerbefreiten Existenzminimums, nach dem sich auch der Mindestunterhalt der zweiten Altersstufe richtet. Davon 87% für die erste Altersstufe und 117% für die dritte Altersstufe sind die gesetzliche Regelung, die man kritisieren kann, aber bei der alljährlichen Anpassung der Düsseldorfer Tabelle zugrunde zu legen ist. Schürmanns Kritik, dass 87% für die erste Altersstufe zu wenig, 117% für die dritte und 125% für die vierte Altersstufe dagegen zu viel seien, beruht inhaltlich im Wesentlichen auf seiner Annahme, dass der Wohnbedarf eines Kindes in allen Altersstufen unverändert bei derzeit 120 € liege. Entgegen seiner Ansicht entspricht das aber nicht der Rechtslage im Unterhaltsrecht, insbesondere auch nicht den von ihm dafür in FamRB 2023, 35 unter Fußnoten 9, 10 zitierten beiden Entscheidungen des BGH vom 29.9.2021 (XII ZB 474/20 = FamRZ 2021, 1965 = FamRB 2022, 9 [M. Schneider]) und vom 18.5.2022 (XII ZB 325/20 = FamRZ 2022, 1366 = FamRB 2022, 342 [Schwamb]). Im Gegenteil liegt diesen beiden Entscheidungen sogar ausdrücklich zugrunde, dass 20% des jeweiligen Unterhaltsbedarfs eines Kindes nach dem zusammengerechneten Einkommen beider Elternteile den Wohnbedarf ausmachen und sich dieser somit ausdrücklich auch nach dem steigenden Lebensalter richtet (gerade anders als nach der abgelehnten, früher teilweise vertretenen Pro-Kopfberechnung). Auch wenn die Verwirklichung dieses Wohnbedarfs sicher nicht immer zeitgleich mit Erreichen der nächsten Altersstufe umgesetzt wird, dürfte es nicht zweifelhaft sein, dass ein Jugendlicher einen höheren Wohnbedarf hat als ein Kleinkind. Jedenfalls entspricht das der unterhaltsrechtlichen Rechtslage (s. o.). Soweit Schürmann die 4. Altersstufe ganz ablehnt, ja sogar für die 18-jährigen einen niedrigeren Bedarf errechnet als für die 12-17-jährigen Jugendlichen, ist seiner Argumentation schon wiederholt entgegen getreten worden (vgl. Schwamb FamRB 2018, 67 ff., 69 und im Experten-Blog vom 21.7.2021 Der Familien-Rechtsberater – Blog (otto-schmidt.de) . Dass in der Tabelle für die 18-jährigen (FamRB 2023, 35) nicht einmal die 15 € für gesellschaftliche Teilhabe auftauchen, die mit Volljährigkeit auf jeden Fall deutlich ansteigt, und auch 3 € für Ausflüge und 14,50 € für den Schulbedarf im letzten Jahr vor dem Abitur untersetzt sind, nimmt dieser Zusammenstellung bereits jede Überzeugungskraft. Auch hier gilt wieder, dass die unterhaltsrechtliche Sicht nicht mit der sozialhilferechtlichen verglichen werden darf, zumal der Sozialhilfesatz für die nicht in Berufsausbildung stehenden arbeitslosen jungen Erwachsenen nicht deren Bedarf entspricht und einen gewissen „Strafcharakter“ hat. Zum wiederholten Mal muss schließlich der aufrechterhaltenen Auffassung widersprochen werden, ein „zu hoch angesetzter Bedarf im Mangelfall“ benachteilige die jüngeren Geschwister. Diese Sichtweise übersieht weiterhin, dass der Einsatzbetrag im Mangelfall der jeweilige Zahlbetrag nach Abzug des Kindergeldes ist (ausführlich Schwamb FamRB 2018, 67 ff., 70). Damit liegt der Einsatzbetrag der privilegierten Volljährigen sogar mit der 4. Altersstufe noch deutlich unter dem der Jugendlichen in der 3. Altersstufe und gerade noch einen Euro über dem der 2. Altersstufe. Auf das Rechenbeispiel im Anhang III. der Frankfurter Unterhaltsgrundsätze 2023 http://www.hefam.de/DT/ffmAPfr.html wird insoweit verwiesen. Von einer Benachteiligung der minderjährigen Geschwister im Mangelfall kann deshalb keine Rede sein.
Last not least überzeugt auch nicht die allerdings von allen Oberlandesgerichten inzwischen übernommene Streichung des „großen“ Selbstbehalts für den Eltern- und Großelternunterhalt (befürwortend Schürmann FamRB 2023, 34 ff, 37 f.). Immerhin enthalten die Frankfurter Unterhaltsgrundsätze noch die Beträge für den Enkelunterhalt (Nr. 21.3.4 und siehe dort auch Nr. 22.3). Das Angehörigenentlastungsgesetz hat eine völlig andere Bedeutung als die Selbstbehalte im Unterhaltsrecht (siehe bereits früher zu § 43 SGB XII: BGH v. 8.7.2015 – XII ZB 56/14, FamRZ 2015, 1467 Rz. 47, 48 = FamRB 2015, 330 [Hauß]). Sofern ein zum Unterhalt für seine Eltern grundsätzlich Verpflichteter mit einem Bruttoeinkommen von knapp über 100.000 Euro herangezogen werden soll, wären die früher von der Rechtsprechung anhand des dafür gebildeten großen Selbstbehalts, über dessen weitere Anpassung ggf. zu diskutieren wäre, entwickelten Grundsätze und vor allem der damit verbundene Familienselbstbehalt (siehe dazu weiterhin Nr. 22.3 der Frankfurter Unterhaltsgrundsätze) immer noch sinnvolle Instrumente für die Praxis, denn auch mit einem solchen Bruttoeinkommen kann es bei berechtigten Abzügen durchaus zu einem Nettoeinkommen führen, bei dem jedenfalls die bisherigen Grundsätze des Familienselbstbehalts, ggf. mit erhöhten Grenzen, weiterhin gebraucht werden könnten.