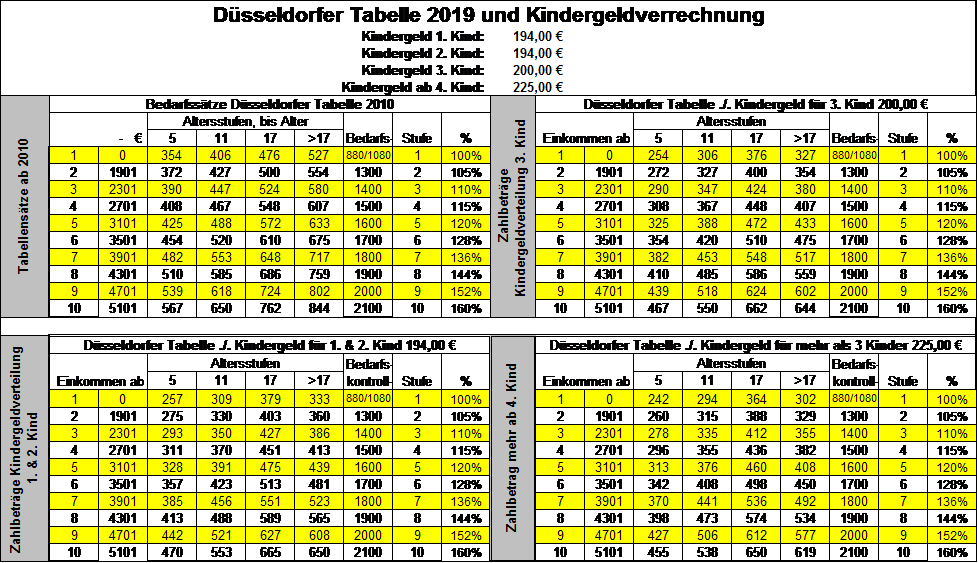Der Sachverhalt ist alltäglich: Im Jahr 1995 übertragen die Eltern ihr Eigenheim an ihre Tochter und behalten sich daran ein lebenslanges Wohnungsrecht vor. 2003 verzichten die Eltern auf das Wohnungsrecht, das im Grundbuch gelöscht wird. Die Tochter vermietet die Wohnung nach dem Tod des Vaters für monatlich 340 € an die Mutter, die im Jahr 2012 in eine Pflegeeinrichtung wechseln muss und seitdem sozialhilfebedürftig ist. Der Sozialhilfeträger macht gegen die Tochter den Rückforderungsanspruch aus § 528 Abs. 1 Satz 1 BGB geltend und verlangt von der Tochter bis zum Tod der Mutter im Jahr 2015 aufgebrachte Sozialhilfeleistungen i.H.v. 22.000 €.
Da zwischen der Schenkung der Immobilie und der Entstehung der Bedürftigkeit der Mutter mehr als zehn Jahre vergangen waren, kommt diese Schenkung als Ansatz für den Rückforderungsanspruch nicht in Betracht (§ 529 Abs. 1 Alt. 2 BGB).
Ansatzpunkt für das Begehren des Sozialhilfeträgers kann daher zunächst nur die im Jahr 2003 erfolgte Löschung des Wohnungsrechts sein. Diese wird von der Rechtsprechung – sofern sie unentgeltlich erfolgt – zu Recht als Schenkung i.S.v. § 516 BGB angesehen. Ihr Wert wird an der Höhe der Wertsteigerung der Immobilie durch Wegfall der dinglichen Belastung bemessen (BGH v. 26.10.1999 – X ZR 69/97, NJW 2000, 728 = MDR 2000, 873; OLG Nürnberg v. 22.7.2013 – 4 U 1571/12, ZEV 2014, 38 = MDR 2014, 22 = ErbStB 2014, 97; Koch in MünchKomm/BGB, 7. Aufl., § 528 Rz. 5 Fn. 26).
Um den Anspruch des Sozialhilfeträgers abzuwehren, könnte man nun auf den Gedanken kommen, die Schenkung herauszugeben, also das Wohnrecht wieder einzuräumen. Dies scheitert indessen daran, dass der Rückforderungsanspruch des verarmten Schenkers lediglich „soweit“ besteht, als er außerstande ist, seinen angemessenen Unterhalt zu bestreiten. D.h. im Umfang des monatlichen Fehlbetrags. Dieser wird durch Wiedereinräumung des Wohnungsrechts indessen nicht realisiert. Das Schenkungsrecht verweist in § 528 Abs. 1 Satz 1 BGB auf das Bereicherungsrecht. Danach hat der Beschenkte, wenn die Herausgabe des Geschenks wegen der Beschaffenheit des Erlangten nicht möglich ist, Wertersatz zu leisten (§ 818 Abs. 2 BGB). Dieser Wertersatzanspruch ist in seiner Höhe begrenzt auf die Höhe der durch die Schenkung verursachten Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB).
Da die Wiedereinräumung des Wohnungsrechts aus den oben dargestellten Gründen zur Abwehr des Zahlungsanspruchs des Sozialhilfeträgers nicht in Betracht kommt, kommt es auf die Höhe der durch die Löschung des Wohnungsrechts eingetretenen Bereicherung der Tochter an. Das OLG Hamm als Vorinstanz hatte angenommen, die Bereicherung der Tochter werde durch die ihr zukommenden Einkünfte aus Vermietung der Wohnung markiert, da die Tochter die Immobilie nicht veräußert und damit die durch den Wegfall des Wohnungsrechts eingetretene Steigerung des Marktwerts der Immobilie nicht realisiert habe (OLG Hamm v. 17.5.2017 – I-30 U 117/16). Dies hat der BGH nicht gelten lassen. Er stellt vielmehr darauf ab, dass der durch den Wegfall der dinglichen Wohnrechtsbelastung entstehende Wertzuwachs der Immobilie die vermögensrechtliche Bereicherung der Tochter darstellt, die gegebenenfalls von dieser herauszugeben ist.
Damit befindet sich der BGH in völliger Übereinstimmung mit seiner bisherigen Rechtsprechung, die für den Wert einer Schenkung auf die Bereicherung des Beschenkten abstellt und nicht etwa auf den Wert des Geschenks für den Schenker. Beide Werte können massiv differieren. Während das lebenslange Wohnrecht für eine 70-jährige Frau an einer Eigentumswohnung deren Verkehrswert auf Null reduzieren wird, weil bei Annahme einer 18-jährigen Restlebensdauer (nach Generationensterbetafeln des Statistischen Bundesamts DESTATIS) sich für eine solche Wohnung kein Käufer finden wird, kann der Gebrauchsvorteil des Wohnrechts für die berechtigte Person einen beachtlichen Vermögenswert darstellen (bei Annahme eines Rechnungszinses von 4 % und einem monatlichen Gebrauchsvorteil von 500 € wären dies ca. 77.000 €, bei Bewertung nach § 14 Abs. 1 Satz 4 BewG i.V.m. der Tabelle des BMF v. 4.11.2016 – IV C 7 – S 3104/09/10001 DOK 2016/101267, die auch für Bewertungsstichtage ab dem 1.1.2018 anzuwenden ist, ergäbe sich ein Betrag i.H.v. 66.492 €).
Das schwer zu vermittelnde Paradoxon der Entscheidung des BGH besteht nun darin, dass die Mutter durch Aufgabe eines für sie im Zeitpunkt des Eintritts ihrer Bedürftigkeit wertlosen Wohnungsrechts, ihre unterhaltsrechtliche Position deutlich verbessert hat, weil der Grundstückswert durch diesen Wegfall der Belastung einen enormen Anstieg erlebt haben kann, der deutlich oberhalb des Werts des Wohnungsrechts liegen wird. Die unterhaltsbedürftige Person verbessert daher durch Aufgabe eines vermögenswerten Rechts im Wege der Schenkung ihre unterhaltsrechtliche Position deutlich. Der inkongruente Verkehrswert des Wohnrechts für den Berechtigten und den Eigentümer bewirkt eine Besserstellung des Schenkers gegenüber der Situation vor der Schenkung. Es besteht nämlich völlige Einigkeit darüber, dass eine pflegebedürftige Person, die Inhaberin eines Wohnungsrechts ist, dieses aber infolge ihrer Pflegebedürftigkeit nicht ausüben kann, keinen Anspruch auf Zahlung in Höhe des fiktiven Mietzinses hat, weil das Wohnrecht unveräußerbar ist (BGH v.13.7.2012 – V ZR 206/11, FamRZ 2012, 1708).
Der BGH hat die Sache zur Entscheidung an das OLG Hamm zurückverwiesen. Dort kann sich nun die beschenkte Tochter darauf berufen, den Wertersatzanspruch der Mutter nur im Rahmen ihrer unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit erfüllen zu können (§ 529 Abs. 2 BGB). Anstelle des altertümlichen Wörtchens „standesgemäß“ ist nach einhelliger Auffassung „angemessen“ zu lesen. Angemessen ist grundsätzlich der entsprechend familienrechtlich zu berechnende Unterhalt nach elternunterhaltsrechtlichen Gesichtspunkten (Palandt/Weidenkaff, 77. Aufl., § 529 BGB Rz. 3). Ob die unterhaltspflichtige Tochter den Wertersatzanspruch aus Ihrem Vermögen zu erfüllen hat, ist bislang nicht entschieden. Da im Elternunterhalt den Unterhaltspflichtigen ein hohes Altersvorsorgeschonvermögen ein geräumt wird (BGH v. 30.8.2006 – XII ZR 98/04, FamRZ 2006, 1511), scheitert der Zahlungsanspruch des Sozialhilfeträgers möglicherweise an der Notbedarfseinrede der Tochter.
Für die anwaltliche Praxis und die beschenkten Kinder ist indessen als Grundsatz festzuhalten, dass die Aufgabe eines Wohnungsrechts an einer Immobilie zum Bumerang werden kann, wenn die wohnberechtigte Person innerhalb der Revokationsfrist von zehn Jahren sozialhilfe- und damit unterhaltsbedürftig wird.