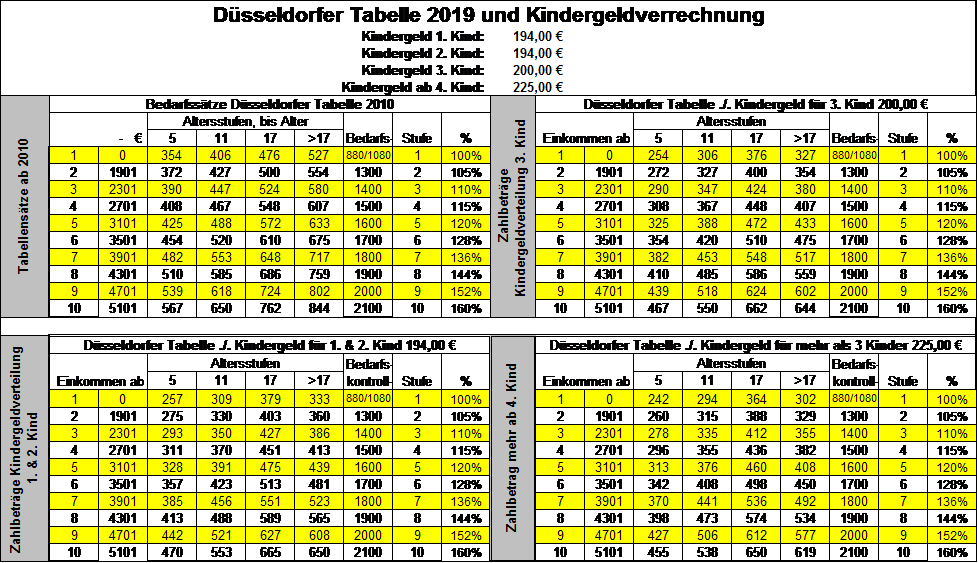Kindschaftsrechtliche Verfahren werden häufig nicht nur durch fehlerhafte rechtliche Vorstellungen von Eltern bestimmt, sondern auch durch eine mangelnde Kommunikation bzw. Kommunikationsfähigkeit zwischen ihnen. Nicht selten werden diese Probleme in einem gerichtlichen Verfahren offengelegt und Eltern zeigen sich bereit – vor allem im Interesse des Kindes -, diese Defizite unter fachlicher Hilfe anzugehen, so dass ggf. die Verfahren mit der erklärten Bereitschaft der Eltern zur Inanspruchnahme angebotener Beratungsmöglichkeiten beendet werden können. Gleichwohl bleibt aber ein bestimmter Anteil von Verfahren, in denen die Eltern sukzessive in eine Hochkonflikthaftigkeit geraten sind, die jeder vergleichsweisen Regelung entgegensteht. Mit der Frage, ob in einer solchen Konstellation dann auch durch gerichtliche Entscheidung die Inanspruchnahme einer Beratung verpflichtend auferlegt werden kann, hat sich aktuell das KG befasst.
In dem zugrunde liegenden Sachverhalt hatten die Eltern ursprünglich bezüglich ihrer gemeinsamen Tochter ein Wechselmodell praktiziert. Aufgrund zunehmender dysfunktionaler Elternkommunikation und einer misstrauischen Grundhaltung beider Elternteile wurde dieses Betreuungsmodell beendet und dem Vater auf seinen Antrag das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Tochter übertragen. Bezüglich der Umgangskontakte der Mutter in den Ferien und an den Feiertagen konnte zwischen den Eltern keine Regelung gefunden werden. Das angerufene Familiengericht hat in seinem Beschluss nicht nur eine Umgangsregelung getroffen, sondern auch angeordnet, dass beide Elternteile jeweils an einem Kurs „Kind im Blick“, einem ähnlichen Kurs oder einer Beratung teilnehmen, darauf gerichtet, sie zu lehren, den Kontakt zum anderen Elternteil im Sinne des Kindes zu gestalten, und über die Teilnahme dem Gericht einen schriftlichen Nachweis vorlegen.
Auf die Beschwerde des Vaters gegen die Anordnung zur Inanspruchnahme der Beratung hat das KG die Anordnung ersatzlos aufgehoben. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass für die angeordnete Verpflichtung zu einer Kursteilnahme keine gesetzliche Grundlage bestehe. Werde durch gerichtliche Entscheidung eine Anordnung getroffen, die der Umsetzung der Loyalitätsverpflichtung gem. § 1684 Abs. 2 BGB dienen soll, so könne diese Anordnung allein auf § 1684 Abs. 3 Satz 2 BGB gestützt werden. Eine solche Anordnung, die zwingend in das Persönlichkeitsrecht der Eltern eingreife, sei nicht mit Zwangsmitteln durchsetzbar. Auch wenn das bei einer bloßen Beratungsauflage nicht in Rede stehe, dürften die Eltern aber nicht zu einer Therapie verpflichtet werden, selbst wenn dies der Schlüssel zu einer nachhaltigen, im Interesse des Kindes erforderlichen Verhaltensänderung sei. Im konkreten Fall habe nicht nur der Vater durchgängig zum Ausdruck gebracht, dass er eine solche Beratung ablehne, sondern auch das Jugendamt den Besuch des Kurses nicht für ein geeignetes Setting erachtet, um den eskalierten Elternkonflikt zu bearbeiten.
Nach § 18 Abs. 3 Satz 3 BGB haben sowohl Eltern als auch andere Umgangsberechtigte bzw. Personen, in deren Obhut sich eine Kind befindet, einen ausdrücklichen Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts. Diese Beratung kann bei einem Träger der Jugendhilfe, d.h. insbesondere bei einem Jugendamt oder einem sonstigen freien Träger in Anspruch genommen werden. Folgend daraus, dass diese Beratung und Unterstützung ausdrücklich als Anspruch auf eine staatliche Leistung ausgestaltet ist, wird in der Rechtsprechung gleichermaßen abgeleitet, dass im Umkehrschluss ein Elternteil dann aber gerade auch nicht gegen seinen Willen zu der Inanspruchnahme einer solchen Beratung verpflichtet werden kann, zumal die Ausgestaltung der Loyalitätsverpflichtung in § 1684 Abs. 2 BGB als Unterlassungspflicht formuliert ist und nicht als Handlungspflicht. Darüber hinausgehend hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung durchgängig klargestellt, dass einem Elternteil zwar aufgegeben werden kann, eine Therapie für ein Kind aufzunehmen bzw. eine bereits begonnene Therapie fortzuführen. Davon abzugrenzen ist allerdings die Therapieverpflichtung des Elternteils selbst. Eine solche ist mangels rechtlicher Grundlage nicht zulässig.
Das KG hat in seiner Entscheidung eine bestehende einheitliche obergerichtliche Rechtsprechung zur Inanspruchnahme von Beratungen fortgeführt, allerdings zutreffend ebenso nachhaltig an die Eltern appelliert, sich zu vergegenwärtigen, dass die Inanspruchnahme der Beratung letztlich vor allem im Interesse des Kindes liegt, d.h. gerade hochkonflikthafte elterliche Beziehungen massiven Einfluss auf die spätere Lebensführung des Kindes haben und zu erheblichen psychischen Belastungen führen können. Dieser Appell des KG kann nur unterstützt werden, da leider Eltern noch zu selten in ihren Auseinandersetzungen erkennen können, dass ihr vermeintlich am Kindeswohl orientiertes Verhalten in der Regel tatsächlich mit dem Kindeswohl nicht in Einklang zu bringen ist.