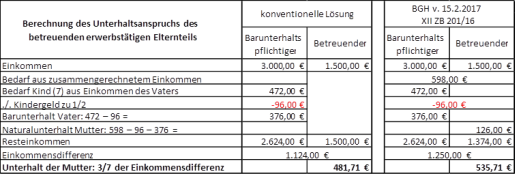In der anwaltlichen Beratungspraxis mehren sich die Beschwerden, dass seitens eines Elternteils Fotos eines gemeinsamen Kindes in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Der Aufforderung, diese Fotos zu löschen, wird häufig mit dem Hinweis begegnet, dass sie ohnehin nicht für jeden Nutzer einsehbar seien, sondern nur dem hierzu erlaubten Personenkreis. Diese Argumentation greift zu kurz. Natürlich geht es zunächst um den Schutz eines Kindes vor Straftätern. Diese können durchaus jedoch auch aus dem familiären Umfeld stammen bzw. es zeigt sich immer wieder, dass auch mit dem Auseinanderbrechen persönlicher Bindungen oder Beziehungen bislang beachtete Grenzen überschritten und „Freunde“ eines sozialen Netzwerks ebenso schnell zu Feinden werden können. Darüber hinausgehend darf auch nicht verkannt werden, dass Fotos, die einen Säugling oder ein Kleinkind zeigen, auch dann im Netz verbleiben, wenn dieses Kind seine eigenen sozialen Kontakte aufgebaut hat und zu einem späteren Zeitpunkt mit diesen ihm dann möglicherweise unangenehmen Bildern aus Kindertagen konfrontiert und bloßgestellt werden kann.
Mit einem entsprechend gelagerten Sachverhalt hat sich aktuell das Amtsgericht – Familiengericht – Stolzenau befasst. Der Vater einer 10-jährigen Tochter hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt Fotos des Kindes im Internet veröffentlicht. Erst auf wiederholte Aufforderung der Mutter hatte er die Fotos dann entfernt. Nachdem er aktuell erneut Fotos auf seinem Facebook-Account veröffentlichte, die von jedem Nutzer eingesehen werden konnten, und auf die Forderung zur Löschung nicht reagierte, beantragte die Mutter des Kindes, ihr das Recht zur Geltendmachung von gerichtlichen Unterlassungsansprüchen zur alleinigen Ausübung zu übertragen. Das Familiengericht ist diesem Antrag gefolgt.
Die rechtliche Situation stellt sich so dar, dass jeder Grundrechtsträger, d.h. auch ein minderjähriges Kind, aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 GG ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung hat, das zugleich das Recht am eigenen Bild schützt. Hieraus folgt die Befugnis, über die Verwendung des Bildes der eigenen Person zu bestimmen und ggf. der Veröffentlichung des Bildes zu widersprechen. Wird diesem Widerspruch keine Folge geleistet, so kann aus den Vorschriften des KunstUrhG i.V.m. §§ 823, 1004 BGB ein Unterlassungsanspruch geltend und auch im gerichtlichen Verfahren durchgesetzt werden. Während der Minderjährigkeit des Kindes obliegt die Wahrnehmung dieser Rechte dem gesetzlichen Vertreter, d.h. bei gemeinsamer elterlicher Sorge den Eltern in gemeinsamer Ausübung. Wird jedoch gerade durch einen Elternteil die Ursache für die Rechtsverletzung gesetzt und ist er zu einer Verhaltenskorrektur nicht bereit, so sieht § 1628 BGB die Möglichkeit vor, die Alleinentscheidungsbefugnis einem Elternteil gerade zu dieser Angelegenheit zu übertragen, d.h. das Gericht trifft keine eigene Entscheidung zu der konkreten Angelegenheit, sondern nur zu der Frage, welcher Elternteil zur Wahrung des Kindeswohls in diesem Fall die Entscheidungskompetenz erhalten soll. § 1628 BGB knüpft dabei an die Frage an, ob es sich um eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung handelt, da Alltagsangelegenheiten ohnehin dem jeweils betreuenden Elternteil obliegen. Die Abgrenzung zwischen Alltagsangelegenheiten und solchen von grundlegender Bedeutung gestaltet sich in der Praxis häufig schwierig, kann allerdings in Anlehnung an die Legaldefinition des § 1687 Abs. 1 S. 3 BGB überprüft werden. Alltagsangelegenheiten sind nur solche, die häufig vorkommen und keine schwer abzuändernden Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben. Zentraler Prüfungsmaßstab ist letztlich das Kindeswohl, d.h. die Frage, welcher Elternteil in der konkret zu entscheidenden Angelegenheit am ehesten geeignet erscheint, die am Kindeswohl orientierte Entscheidung zu treffen. Hier hat das AG Stolzenau gem. § 1628 BGB der Mutter die Entscheidungsbefugnis übertragen, für die gemeinsame Tochter einen Unterlassungsanspruch gem. § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB i.V.m. §§ 823 Abs. 2 BGB, 22, 23 KUG gegen den Vater geltend zu machen.
In der Praxisberatung sollte im Mandantengespräch sehr deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Veröffentlichung von Kinderfotos in sozialen Netzwerken nicht leichtfertig behandelt werden darf. Auch mit Blick auf zwischenzeitlich veröffentlichte ausdrückliche diesbezügliche Warnungen der Polizei sollten die Eltern für die dem Kind drohenden Gefahren sensibilisiert und einem uneinsichtigen Elternteil ggf. mit einer gerichtlichen Entscheidung zwingend aufgegeben werden, die zum Schutz des Kindes notwendigen Maßnahmen zu veranlassen.