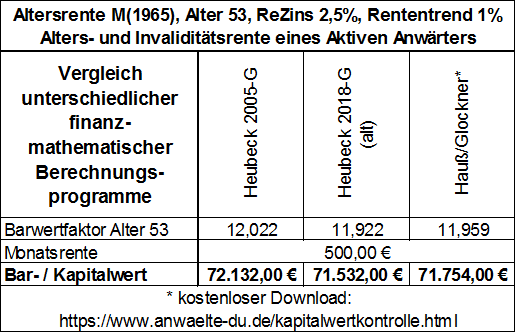Nicht immer sind die Vorstellungen sich trennender Eltern, für das gemeinsame Kind bestmögliche und insbesondere einvernehmliche Regelungen zu finden, auch dauerhaft. Allzu leicht werden angestrebte Ideale durch die alltäglichen Realitäten eingeholt und eine zunächst avisierte und zugesicherte Fortdauer der gemeinsamen Betreuung des Kindes bereut. In dem sich dann eröffnenden Spannungsfeld zwischen den Vorstellungen der Eltern zur künftigen Wahrnehmung der elterlichen Verantwortung und dem Interesse des Kindes an der Beibehaltung einer nicht nur kurzfristig praktizierten Betreuungsform, wird häufig übersehen, dass stets das Kindeswohl zentraler Bewertungsmaßstab ist.
Mit einem entsprechend gelagerten Sachverhalt hat sich aktuell auch das KG befasst:
Die gemeinsam sorgeberechtigte Eltern eines 2015 geborenen Kindes hatten im Oktober 2016 eine gerichtlich gebilligte Vereinbarung schlossen, in der ein bereits seit ihrer Trennung praktiziertes Wechselmodell bestätigt wurde. In einer weiteren Vereinbarung vom April 2017 haben sie sodann Ergänzungen zu den Wochenendregelungen vorgenommen. In Abweichung dieser Vereinbarungen erstrebte die Mutter dann jedoch wieder eine Verlagerung des Lebensmittelpunkts des Kindes in ihrem Haushalt. Das Gericht hat jedoch ein paritätisches Wechselmodell angeordnet. Die gegen diesen Beschluss eingelegte Beschwerde der Mutter blieb ebenso erfolglos wie die Anschlussbeschwerde des Vaters, die er in zeitlicher Folge einlegte und mit der er dann ebenfalls die Verlagerung des Lebensmittelpunkt des Kindes in seinen Haushalt anstrebte.
Das KG hat in seiner Entscheidung hervorgehoben, dass eine familiengerichtlich gebilligte Vereinbarung zur Ausgestaltung des Umgangs beider Eltern mit dem Kind vorliege und die Abänderung dieser Vereinbarung – sei es hin zu einem Wechselmodell oder davon distanzierend – dem engen Maßstab jeder Änderung einer familiengerichtlichen Entscheidung unterliege, d.h. die Änderung aus triftigen, das Wohl des Kindes nachhaltig berührenden Gründen angezeigt sein müsse. Dabei habe der Kontinuitätsgrundsatz zentrale Bedeutung. Im konkreten Sachverhalt sei daher zu beachten, dass praktisch seit dem siebten Lebensmonat des Kindes kontinuierlich eine Betreuung im Wechselmodell durchgeführt worden sei und dadurch, nach den Feststellungen der Sachverständigen, das Kind beide Eltern als zuverlässige Bezugs- und Erziehungspersonen erlebt habe. Selbst wenn man den Lebensmittelpunkt des Kindes zu der Mutter verlagere, seien hierdurch nicht zwingend von ihr im Fall der weiteren Umsetzung des Wechselmodells befürchtete Belastungssymptome oder Verlustängste des Kindes ausgeschlossen, da auch in diesem Fall das Kind in regelmäßigen Abständen in den väterlichen Haushalt wechsele. Auch Einschränkungen in der Kommunikation der Eltern stünden dem Wechselmodell nicht entgegen, denn trotz dieser Einschränkungen seien die Eltern gleichwohl in der Lage gewesen, wichtige Entscheidungen für das Kind zu treffen, wobei zudem beide Eltern sich auch gegenüber der Sachverständigen dafür ausgesprochen hätten, sich eine Fortführung des Wechselmodells vorstellen zu können. Für die elterliche Kommunikation sei es letztlich auch unerheblich, ob das Kind überwiegend im Haushalt der Mutter lebe. Entscheidend sei vielmehr die bestehende gemeinsame elterliche Sorge, die eine Einigung der Eltern zu Belangen des Kindes erfordere.
Die Entscheidung des KG steht nicht in Widerspruch zu der Grundsatzentscheidung des BGH v. 1.2.2017 – XII ZB 601/15, FamRB 2017, 136, in der zwar betont wurde, dass ein paritätisches Wechselmodell gerade nicht zu dem Zweck angeordnet werden kann, eine nicht bestehende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Eltern überhaupt erst herzustellen. Davon zu unterscheiden ist aber die Konstellation, dass Elterngespräche zwar von trennungstypischen Belastungen überlagert werden, gleichwohl jedoch die Eltern in der Lage sind, solche Gespräche dem Grunde nach überhaupt zu führen und es ihnen dabei zudem gelingt, wesentliche Frage für die Entwicklung des Kindes – in Umsetzung einer nach wie vor bestehenden gemeinsamen elterlichen Sorge – einer Lösung zuzuführen.
Die Entscheidung des KG führt den Blick allerdings auch auf ein immer wieder auftretendes Problem der Praxis, die Abänderungsvoraussetzungen einer bestehenden familiengerichtlichen Regelung zur elterlichen Sorge oder zum Umgangsrecht. Häufig wird verkannt, dass unter der Existenz einer bestehenden familiengerichtlichen Regelung der besonders enge Abänderungsmaßstab des § 1696 Abs. 1 BGB gilt, d.h. es hierzu triftiger und nachhaltiger am Kindeswohl ausgerichteter Gründe bedarf. Durch diese hohen Abänderungshürden soll für das Kind nicht nur ein verlässlicher Daseinsschwerpunkt gewährleistet werden, sondern eine ebenso gesicherte Erziehungskontinuität, da die Dauerhaftigkeit familiärer Bindungen für eine stabile und sichere psychosoziale Entwicklung des Kindes elementare Bedeutung haben, die allerdings durch eine ständiges Wiederaufrollen abgeschlossener familiengerichtlicher Verfahren in Frage gestellt werden.