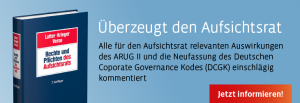Auch die Saison der Aktionärstreffen im Jahr 2021 war von der virtuellen Hauptversammlung geprägt. Die fortdauernde COVID‑19-Pandemie erforderte, das COVMG zu verlängern, um rechtssicher eine zweite Saison von Online-Hauptversammlungen durchführen zu können. Nachdem zum Jahreswechsel das im Verordnungswege zur Verlängerung ermächtigte BMJV und der Deutsche Bundestag fast zeitgleich zur Tat schritten, trat mit Wirkung zum 28.2.2021 ein leicht überarbeitetes COVMG in Kraft. Auf Grundlage des novellierten Gesetzes wurden bis Ende Juli 2021 von den Unternehmen der DAX-Indexfamilie (DAX30, MAX, SDAX und TecDAX) 134 Hauptversammlungen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Versammlung einberufen. Anknüpfend an die Beiträge in AG 2020, 418 und AG 2020, 776 wurde nunmehr die zweite virtuelle Hauptversammlungssaison empirisch untersucht und systematisch ausgewertet, um den Marktstandard herauszuarbeiten.
Die Mehrheit der 134 zwischen Februar 2021 und dem 31.7.2021 einberufenen virtuellen Hauptversammlungen von börsennotierten Unternehmen der DAX-Indexfamilie
- nutzte das normale statt des verkürzten Fristenregimes des § 1 Abs. 3 COVMG (99 %),
- sah vor, dass die Versammlung über das Internet in Bild und Ton nur für die Aktionäre übertragen würde (58 %),
- gab einen „Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes“ in Form einer Postadresse als Ort der Hauptversammlung i.S.d. § 121 Abs. 3 AktG an (57 %),
- gab Aktionären vor, Fragen gem. § 1 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 COVMG bis spätestens einen Tag vor der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen (100 %),
- beschrieb das Fragerecht gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVMG im Zusammenhang mit Angaben nach § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG (80 %),
- eröffnete den Aktionären die Möglichkeit, Fragen gem. § 1 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 COVMG bis zum Ablauf des zweiten Tages vor der Hauptversammlung zu übermitteln (96 %), so dass ein voller Tag zwischen der letzten Fragemöglichkeit und dem Tag der virtuellen Versammlung lag,
- nutzte das Portal zur Übermittlung der Fragen an die Gesellschaft (98 %),
- machte keine Angaben zur Namensnennung der Fragensteller in der virtuellen Versammlung (46 %),
- bot ihren Aktionären weder eine Nachfragemöglichkeit (92,5 %) noch eine Stellungnahmemöglichkeit (81 %) während der virtuellen Hauptversammlung an,
- ermöglichte keine elektronische Teilnahme gem. § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG (99 %) und stellte dies auch explizit in der Einberufung der virtuellen Versammlung klar (60 %),
- bot den Aktionären die Briefwahl über das Portal (100 %) und daneben auch auf dem Postweg, per Telefax oder E‑Mail an (63 %),
- ermöglichte den Aktionären, die elektronische Briefwahl über das Portal bis zum „Beginn der Abstimmungen“ (67 %) und die Briefwahl auf dem Postweg, per Telefax oder E‑Mail bis zum Ablauf des Tages vor der virtuellen Hauptversammlung (62 %),
- benannte einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (100 %),
- sah vor, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das Portal (99 %) und daneben auch auf dem Postweg, per Telefax oder E‑Mail bevollmächtigen und anweisen zu können (69 %),
- ermöglichte die Bevollmächtigung und Anweisung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft über das Portal bis zum „Beginn der Abstimmungen“ (68 %) und beendete die Möglichkeit der Bevollmächtigung und Anweisung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft auf dem Postweg, per Telefax oder E‑Mail mit Ablauf des Tages vor der virtuellen Hauptversammlung (60 %),
- gab an, Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung während der virtuellen Hauptversammlung über das Portal erklären zu können (95 %), und
- wählte Computershare (40 %), Link Market Services (18 %) oder Better Orange (17 %) als Hauptversammlungs-Dienstleister für die Vorbereitung und Durchführung der virtuellen Hauptversammlung (Marktanteil von zusammen 75 %).
In der AG 2021, 613 werden die Durchdringung der virtuellen Hauptversammlung gegenüber der Präsenz-Versammlung, der Umgang mit dem Fristenregime der Einberufung, dem (neuen) Fragerecht, der Ermöglichung von Nachfragen bzw. Stellungnahmen, den Modalitäten der Stimmrechtsausübung der Aktionäre sowie der Widerspruchsmöglichkeit ausführlich dargestellt und ausgewertet. Auch werden weitere Besonderheiten der virtuellen Hauptversammlung und die von den untersuchten Börsenunternehmen gewählten Hauptversammlungs-Dienstleister beleuchtet.