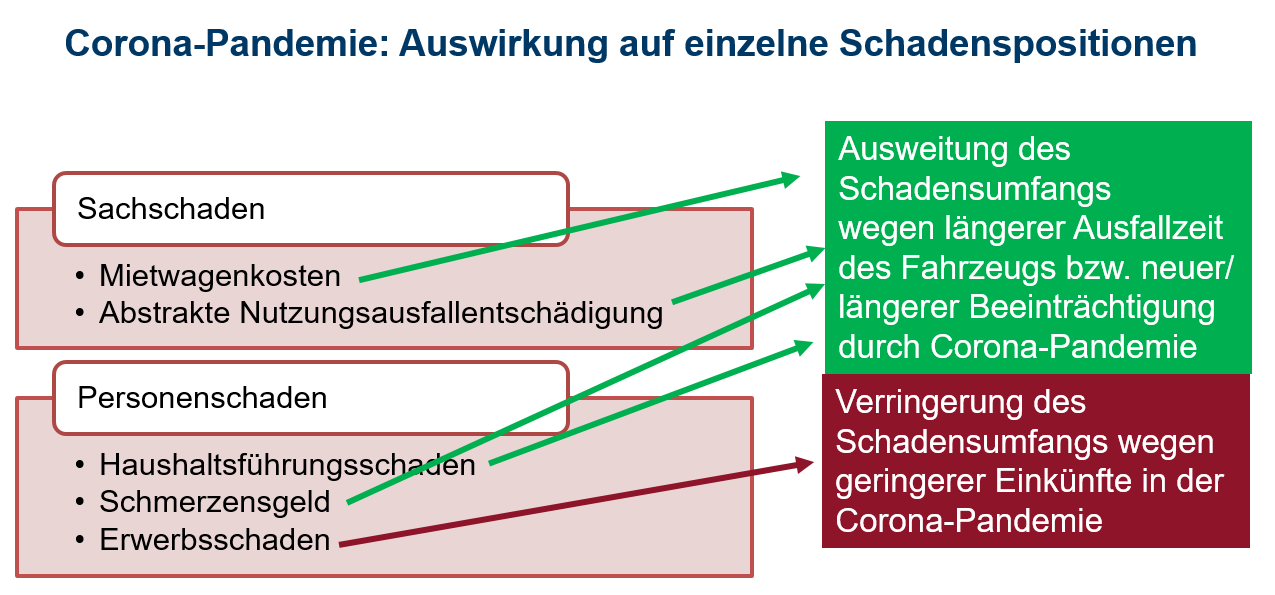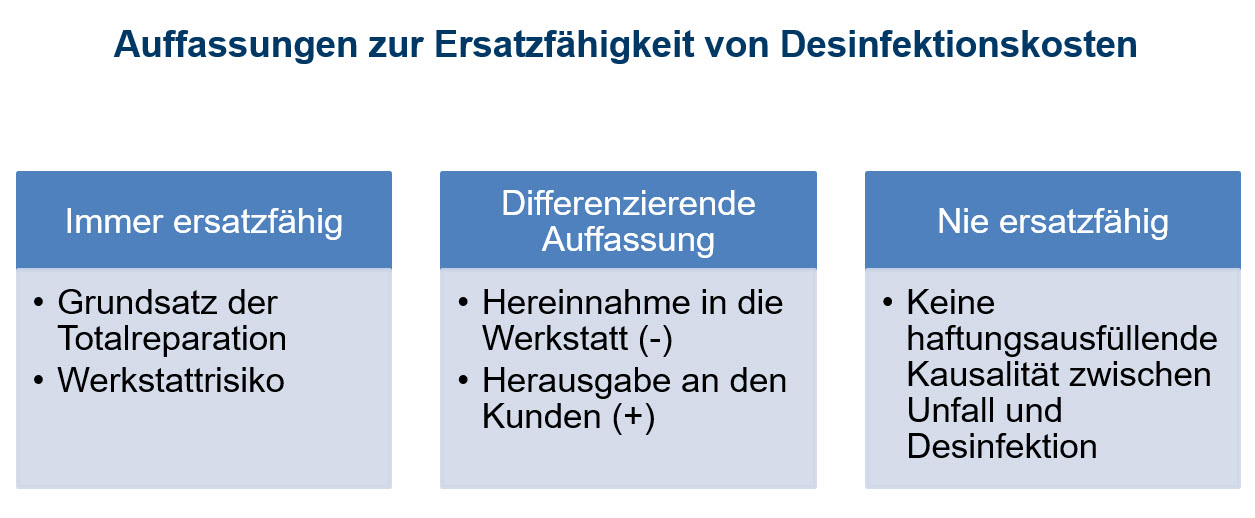Wieder einmal hat ein simpler Verkehrsunfall dem BGH Gelegenheit geboten, die Funktion des Anscheinsbeweises bei der Haftungsabwägung zurechtzurücken. Zwei Pkw waren zusammengestoßen. Der eine wurde aus einer Grundstückszufahrt rückwärts auf eine Einbahnstraße herausgefahren, der andere setzte auf dieser ein Stück zurück, um einem ausparkenden Fahrzeug Platz zu machen und diese Parklücke dann selbst zu nutzen. Der Ausfahrende behauptete, sein Pkw habe schon gestanden, als der zurückstoßende mit ihm kollidierte, und verlangte daher 100-prozentigen Schadensersatz. Die Unfallgegnerin brachte vor, beide Fahrzeuge seien zeitgleich rückwärts gefahren; ihre Versicherung zahlte daher nur 40 %. Das AG sprach dem Kl. den vollen Schadensersatz zu, das LG wies die Klage ab. Der BGH hob das Urteil auf und verwies die Sache zur endgültigen Bemessung der Haftungsquote ans LG zurück (Urt. v. 10.10.1023 – VI ZR 287/22).
Das LG gründete seine Entscheidung auf drei Anscheinsbeweise: Zwei davon sprächen für ein Verschulden des Klägers, denn er sei rückwärts und noch dazu aus einer Grundstückszufahrt herausgefahren, die Fahrerin des anderen Pkw sei nur rückwärts gefahren. Ein Zurücksetzen um wenige Meter sei auch in einer Einbahnstraße zulässig und ändere nichts an der Vorfahrt. Der Kläger hafte daher zum größeren Teil.
Dieses Urteil konnte der BGH aus zwei Gründen nicht bei Bestand lassen. Zum einen weil die Beklagte sich durchaus eines Verstoßes gegen das in Einbahnstraßen bestehende Rückwärtsfahrverbot schuldig gemacht habe. Allenfalls unmittelbar zum Einparken oder beim Herausfahren aus einem Grundstück dürfe dort kurz rückwärts gefahren werden, nicht um in eine zum Einparken geeignete Position zu gelangen.
Vor allem aber musste der BGH erneut die fehlerhafte Anwendung des Anscheinsbeweises beanstanden. Nach einem in der instanzgerichtlichen Praxis offenbar nicht auszurottenden Missverständnis dieses Rechtsinstituts wird aus einem bestimmten Fahrverhalten ein in die Haftungsabwägung eingehendes Verschulden abgeleitet (hier sogar mittels dreier teilweise gegeneinander streitender Anscheinsbeweise). Der BGH weist demgegenüber erneut darauf hin, dass der Anscheinsbeweis für ein schuldhaftes Verhalten nicht allein auf einen Sachverhaltskern (z.B. das Herausfahren aus einem Grundstück) gestützt werden darf, sondern einen solchen Schluss nur zulässt, wenn das gesamte feststehende Unfallgeschehen nach der Lebenserfahrung typisch für ein schuldhaftes Handeln ist. Dies könne nur aufgrund einer umfassenden Betrachtung aller tatsächlichen Elemente des Gesamtgeschehens beurteilt werden, wozu hier auch das nicht zu erwartende Rückwärtsfahren in einer Einbahnstraße gehöre.
Zu Recht nimmt der BGH diesen an sich banalen Fall zum Anlass, erneut eine zurückhaltende Anwendung des Anscheinsbeweises anzumahnen, „weil er es erlaubt, bei typischen Geschehensabläufen aufgrund allgemeiner Erfahrungssätze auf einen ursächlichen Zusammenhang oder ein schuldhaftes Verhalten zu schließen, ohne dass im konkreten Fall die Ursache bzw. das Verschulden festgestellt ist“.
Eingehend zu Dogmatik und Kasuistik des Anscheinsbeweises Greger, in: Greger/Zwickel, Haftung im Straßenverkehr, 6. Aufl. 2021, Rz 41.56 ff.