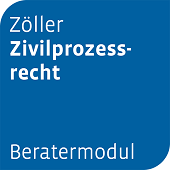Sieht man von gelegentlichen technischen Pannen ab, hat sich die Übermittlung von Anwaltsschriftsätzen an die Gerichte über das besondere elektronische Anwaltspostfach gut eingespielt. Der Nutzer muss aber auch umsichtig mitspielen, so z.B. beim Signieren des Schriftstücks.
Nach § 130a Abs. 3 Satz 1 ZPO genügt bei der Nutzung des beA die einfache Signatur, d.h. die Namensangabe der verantwortenden Person. Diese ist aber auch erforderlich. Es genügt nicht, den Schriftsatz – wie zu früheren Zeiten – mit der Angabe „Rechtsanwalt“ und einer unleserlichen (eingescannten) Unterschrift zu versehen. Selbst wenn sich aus dem Briefkopf Rückschlüsse auf den Unterzeichner ziehen lassen (z.B. weil dort nur ein Rechtsanwalt oder nur eine Rechtsanwältin aufgeführt ist), liegt keine wirksame Einreichung des Schriftsatzes vor (so BGH v. 7.9.2022 – XII ZB 215/22, MDR 2022, 1362). Das BAG hat zwar kurz zuvor entschieden, dass bei einem Rechtsanwalt, der im Briefkopf als Einzelanwalt ausgewiesen wird, regelmäßig der maschinenschriftliche Abschluss des Schriftsatzes mit „Rechtsanwalt“ für die einfache Signierung ausreicht (BAG v. 25.8.2022 – 2 AZN 234/22, NJW 2022, 3028). Ob sich diese Auffassung durchsetzt, ist aber ungewiss. Man sollte nicht darauf vertrauen und vorsichtshalber den Namen angeben oder eine Unterschrift einscannen. Aber auch dabei ist Vorsicht geboten: Die Unterschrift muss leserlich sein, d.h. auch ohne Sonderwissen den Namen des Urhebers erkennen lassen (BSG v. 16.2.2022 – B 5 R 198/21 B, NJW 2022, 1334).
Vorsicht ist ferner am Platze, wenn man sich des für eine Berufsausübungsgesellschaft eingerichteten beA bedient (was seit August dieses Jahres möglich ist; s. Zöller § 130a ZPO Rn. 11a). Die BRAK hat mitgeteilt, dass es aufgrund von technischen Gegebenheiten in der Justiz derzeit nicht möglich ist, die Identität der Person zu übermitteln, die im Zeitpunkt des Versands der Nachricht am Gesellschafts-beA angemeldet war. Das Gericht kann daher nicht feststellen, ob die den Schriftsatz verantwortende Person mit der ihn versendenden Person identisch ist.
Zur Vermeidung möglicher Nachteile empfehlen BRAK und Deutscher Anwaltverein, Schriftsätze, die aus dem beA der Berufsausübungsgesellschaft eingereicht werden sollen, qualifiziert elektronisch zu signieren oder zumindest darauf zu achten, dass der verantwortende Rechtsanwalt sich selbst am Kanzlei-beA anmeldet und das Dokument persönlich versendet. Zur Sicherheit sollte sodann ein Auszug aus dem Nachrichtenjournal, welches erkennen lässt, welche Nutzerin oder welcher Nutzer am Kanzlei-beA angemeldet war, zur Akte genommen werden. Damit lasse sich auch später nachweisen, welche Rechtsanwältin oder welcher Rechtsanwalt die Nachricht versandt hat.
Der Zöller ist das Standardwerk zur ZPO und ein Muss für jeden Prozessualisten. Die Autoren des Zöller informieren im „Blog powered by Zöller“ regelmäßig über einschlägige Gesetzesentwicklungen und aktuelle Rechtsprechung.