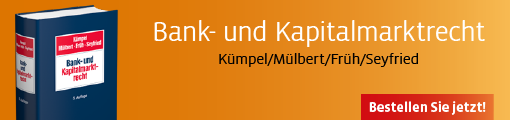Am Mittwoch, den 24.11.2021, haben SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP den Koalitionsvertrag präsentiert, der auf den Titel „Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ lautet. Bei der Lektüre des 178 Seiten langen Textes fällt auf, dass die Ampel-Koalition zwei unternehmensrechtliche Themen, die früher Gegenstand von Wahlkämpfen waren, nicht aufgreift: die Geschlechterquote in den Gesellschaftsorganen und die Managervergütung. Augenscheinlich ist das Unternehmensrecht in diesem Zusammenhang fortschrittlich genug und muss nicht angetastet werden. Im Hinblick auf die Reformen der vergangenen Jahre bleibt zu hoffen, dass sich die Koalitionäre an ihr Schweigen halten. Der Schwerpunkt der unternehmensrechtlichen Reformvorhaben liegt in anderen Bereichen, die im Folgenden dargestellt werden.
Sorgfaltspflichten in den Lieferketten
Am Ende der vergangenen Legislaturperiode hat der deutsche Gesetzgeber das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG; BGBl. I 2021, S. 2959) verabschiedet (zum Entwurf vom März 2021 Reich, AG 2021, R116; Scheffler, AG 2021, R120; zur Endfassung Scheffler, AG 2021, R199). Außerdem hat das Europäische Parlament im März 2021 einen Legislativvorschlag zur Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen präsentiert. Der für Herbst 2021 erwartete Richtlinienentwurf der EU-Kommission liegt bislang nicht vor. An diese Entwicklung anknüpfend halten die Ampel-Koalitionäre auf S. 34 fest, dass sie ein wirksames EU-Lieferkettengesetz unterstützen, das kleinere und mittlere Unternehmen nicht überfordert. Das deutsche LkSG werde unverändert umgesetzt und ggf. verbessert. Insgesamt wäre die Bundesregierung wohl gut beraten, zunächst die Entwicklungen auf europäischer Ebene abzuwarten und ggf. zu versuchen, sie zu beeinflussen. Erst wenn das Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene ins Stocken geraten oder gar scheitern sollte, wäre es zweckmäßig, das LkSG nachzubessern.
Whistleblowing
Anders als das LkSG hat es ein Hinweisgeberschutzgesetz in der vergangenen Legislaturperiode nicht mehr über die Ziellinie geschafft. In dieser Legislaturperiode ist hiermit sicher zu rechnen, da die Whistleblowing-Richtlinie (EU) 2019/1937 vom 23.10.2019 den Mitgliedsstaaten Regelungen zum Whistleblowing zwingend zur Umsetzung vorgibt. Da die Umsetzungsfrist bereits am 17.12.2021 endet, wäre es nicht überraschend, wenn das Whistleblowing zu denjenigen unternehmensrechtlichen Themen zählt, die die Ampel-Koalitionäre prioritär angehen.
Die Essenz der Umsetzung deutet der Koalitionsvertrag auf S. 111 nur vage an. Zu begrüßen ist die ausdrückliche Festlegung, insofern über eine Eins-zu-eins-Umsetzung hinauszugehen, als das angestrebte Regime nicht auf die Meldung von Verstößen gegen EU-Recht beschränkt bleiben soll, sondern auch bestimmte Verstöße gegen nationale Vorschriften umfasst sein sollen. Abgesehen hiervon wäre es der Rechtssicherheit und Praktikabilität dienlich, wenn der Gesetzgeber Klarheit hinsichtlich der Frage schafft, ob und inwieweit Hinweisgebersysteme im Konzern einheitlich betrieben werden können (hierzu Holle, ZIP 2021, 1950). Die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen wegen Repressalien gegen den Schädiger stellen die Ampel-Koalitionäre unter einen Prüfvorbehalt, so dass abzuwarten bleibt, inwieweit sie sich dazu durchringen werden, Beratungs- und finanzielle Unterstützungsangebote vorzusehen.
Verbandssanktionen
Kein unionsrechtlicher Umsetzungsdruck besteht beim Thema Verbandssanktionierung. Die gegenwärtige Rechtslage wird von vielen aus guten Gründen aber als unbefriedigend empfunden; die in der letzten Legislaturperiode anvisierte Neuaufstellung des Rechts der Verbandssanktionierung ist auf der Zielgeraden gescheitert. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass der Koalitionsvertrag sich ihrer auf S. 111 neuerlich annimmt. Ob sich dahinter eine ähnlich weitreichende Neuaufstellung des Rechts der Verbandssanktionierung verbirgt, wie sie der in der vergangenen Legislaturperiode vorliegende Regierungsentwurf eines Verbandssanktionengesetzes (VerSanG; BT-Drucks. 19/23568) bedeutet hätte, ist fraglich. Tendenziell klingt es nach einer kleinen Lösung, die sich mit einer Anhebung der Bußgeldobergrenzen, der Normierung einer Compliance-Defense sowie gewisser Regelungen zu internen Untersuchungen im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechts begnügt.
GmbH mit gebundenem Vermögen
Ein klares Bekenntnis geben die Ampel-Koalitionäre auf S. 30 des Vertrags zu einer neuen Rechtsform ab, die im Schrifttum sehr umstritten ist: die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen (für die Einführung einer solchen Gesellschaftsform Sanders/Dauner-Lieb/Kempny/Möslein/Veil, GmbHR 2021, 285; dagegen etwa Habersack, GmbHR 2020, 992). Den Einsatz dieser Rechtsform als Vehikel für Steuersparkonstruktionen will die künftige Regierung vermeiden (auf diese Gefahr hinweisend Hüttemann/Schön, DB 2021, 1356; relativierend Kempny, DB 2021, 2248). Ungeachtet der steuerrechtlichen Probleme sollte der Gesetzgeber überprüfen, ob es einer solchen Gesellschaftsform tatsächlich bedarf, um die angestrebten Ziele zu erreichen (eingehend Hüttemann/Rawert/Weitemeyer, npoR 2020, 296).
GmbH-Gründungsrecht
Darüber hinaus verpflichten sich die Koalitionäre auf S. 111 f. des Vertrags, die Gründung von Gesellschaften zu erleichtern, indem sie Beurkundungen per Videokommunikation auch bei Gründungen mit Sacheinlage und weiteren Beschlüssen erlauben. Die Ampel dürfte damit in erster Linie die GmbH im Blick gehabt haben. Auch wenn keine sachlichen Gesichtspunkte gegen eine elektronische AG-Gründung sprechen, dürfte dies trotz aller Fortschrittsbekundungen auch künftig keine Option sein.
Der Koalitionsvertrag setzt an § 2 Abs. 3 GmbHG i.d.F. des DiRUG (BGBl. I 2021, S. 3338) an, wonach nur eine elektronische GmbH-Bargründung möglich ist. Diese Einschränkung, die im Schrifttum kritisiert wurde (s. nur Drygala/Grobe, GmbHR 2020, 985 Rz. 32 ff.), soll in der Zukunft entfallen, was nachdrücklich zu begrüßen ist. Die Unternehmensgründung soll zudem durch eine umfassende Start-Up-Strategie gefördert werden, zu der u.a. die Einführung von flächendeckenden „One Stop Shops“ (Anlaufstellen für Gründungsberatung, -förderung und -anmeldung) gehört. In solchen „One Stop Shops“ sollen Unternehmensgründungen innerhalb von 24 Stunden möglich sein (S. 30 des Koalitionsvertrags).
Hauptversammlungsrecht
Auf einhellige Zustimmung dürfte die auf S. 112 des Koalitionsvertrags angekündigte dauerhafte Einführung von Online-Hauptversammlungen fallen. Die auf Corona-Sondergesetzgebung gestützte Online-Hauptversammlung (s. § 1 COVMG) hat sich im Groben und Ganzen bewährt (zur Empirie s. nur Danwerth, AG 2021, 613) und kann als Blaupause für die anstehende Aktienrechtsreform dienen.
Spannend bleibt die Frage, wie die Aktionärsrechte im künftigen Hauptversammlungsrecht ausgestaltet werden. Die Ampel-Koalition verspricht, jene uneingeschränkt zu wahren. Dies deutet darauf hin, dass die Regelungen in § 1 Abs. 1, 2 und 7 COVMG, die das Rede-, Auskunfts- und Anfechtungsrecht der Aktionäre beschränken, nicht ins Aktiengesetz überführt werden (speziell zur Aktionärskommunikation Seibt/Danwerth, AG 2021, 369 und VGR, AG 2021, 380 Rz. 8 ff.). Ungeachtet der rechtspolitischen Diskussionen um die Reichweite der Aktionärsrechte sollte das BMJ zügig einen Referentenentwurf präsentieren, damit die Unternehmen nach den Erfahrungen mit § 1 COVMG in der Hauptversammlungssaison 2023 nicht wieder im vordigitalen Zeitalter landen (zu COVMG-Verlängerungen und der Zeitschiene für die Aktienrechtsreform Danwerth, AG 2021, R283 f.).
Die Ampel-Koalition sollte die Digitalisierung der Hauptversammlung dafür nutzen, auch das Beschlussmängelrecht zu reformieren. Die Große Koalition, die eine solche Reform auf S. 131 des Koalitionsvertrags für die 19. Legislaturperiode angekündigt hatte, hat ihr Versprechen trotz umfassender rechtspolitischer Vorschläge nicht umgesetzt (s. nur die Beschlüsse des 72. Deutschen Juristentags, S. 27 ff. und die Vorschläge des AK Beschlussmängelrecht, AG 2008, 617).
Überdies sollte die künftige Regierung erwägen, die Möglichkeit einer digitalen Versammlung auch für die Gesellschaftsorgane und andere Gesellschaftsformen auf eine sichere Rechtsgrundlage zu stellen. Wie die Corona-Pandemie gezeigt hat, besteht nicht nur für die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft ein Bedarf an virtuellen Sitzungen.
Elektronische Aktie
In der 19. Legislaturperiode hat der Gesetzgeber mit dem eWpG (BGBl. I 2021, S. 1423) die Möglichkeit geschaffen, elektronische Wertpapiere zu begeben (hierzu nur Sickinger/Thelen, AG 2020, 862; Sickinger/Thelen, AG 2021, R198). Gleichwohl beschränkt sich das Gesetz gem. § 1 eWpG auf Inhaberschuldverschreibungen; die Begebung elektronischer Aktien ist nicht möglich (s. Begr. RegE, BT-Drucks. 19/26925, 38). Dies könnte sich in der 20. Legislaturperiode ändern: Beiläufig erwähnt der Koalitionsvertrag auf S. 172 unter der Überschrift „Digitale Finanzdienstleistungen und Währungen“, die Emission elektronischer Aktien zu ermöglichen (zu den gesellschaftsrechtlichen Herausforderungen Guntermann, AG 2021, 449).
Kapitalmarktrecht
Positiv ist zu würdigen, dass sich die Ampel auf den S. 169 ff. des Koalitionsvertrags zur Vertiefung der Kapitalmarktunion bekennt und die Barrieren für grenzüberschreitende Kapitalmarktgeschäfte in der EU abbauen, den Zugang von KMU zum Kapitalmarkt erleichtern und die Markttransparenz stärken möchte. Auch die Schaffung eines angemessenen regulatorischen Rahmens für FinTechs und vergleichbare Unternehmen ist zu begrüßen. Gleichwohl sollte die künftige Regierung bei all der Regulierungsfreude bedenken, dass sich die enorme Regelungsdichte im Kapitalmarktrecht als ein Grund dafür erweist, den Kapitalmärkten fernzubleiben. Vor diesem Hintergrund sollte die Ampel erwägen, ob weniger (und klarer!) nicht doch mehr ist.
Mitbestimmungsrecht
Auf S. 72 kündigen die Koalitionäre an, sich für die Weiterentwicklung der Unternehmensmitbestimmung einzusetzen, so dass es nicht mehr zur vollständigen Mitbestimmungsvermeidung beim Zuwachs von SE-Gesellschaften kommen kann (Einfriereffekt). Das klingt für zahlreiche Gesellschaften, die (noch) nicht der Unternehmensmitbestimmung unterliegen, wie eine Einladung zur zügigen Umwandlung in eine SE, um rechtzeitig die derzeit bestehende Möglichkeit auszunutzen, das Mitbestimmungsstatut einzufrieren.
Prozessrecht
Aus der Perspektive des Unternehmensrechts interessant sind die Aussagen auf S. 108 des Koalitionsvertrags, wonach das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) – das in der 19. Legislaturperiode ohne inhaltliche Änderungen verlängert wurde (BGBl. I 2020, S. 2186) – modernisiert werden soll und englischsprachige Spezialkammern für internationale Handels- und Wirtschaftsstreitigkeiten ermöglicht werden sollen.
Steuer- und Geldwäscherecht
Fernwirkungen auf das Unternehmensrecht dürften manche steuer- und geldrechtlichen Pläne haben. So sprechen die Koalitionäre auf S. 167 des Vertrags davon, aufbauend auf den Maßnahmen der letzten Legislaturperiode missbräuchliche Dividendenarbitragegeschäfte zu unterbinden. Ein weiteres Reformversprechen betrifft das Transparenzregister. Auf S. 171 f. des Koalitionsvertrags kündigt die künftige Regierung an, die Qualität der Daten im Transparenzregister zu verbessern, so dass die wirtschaftlich Berechtigten in allen vorgeschriebenen Fällen tatsächlich ausgewiesen werden.
Mehr zum Unternehmensrecht im Koalitionsvertrag im AG-Report 24/2021.