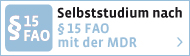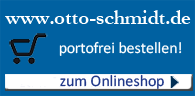Diese Woche geht es um die Präklusion von Vorbringen nach einer gemäà § 264 ZPO privilegierten Antragsänderung im Berufungsverfahren. Präklusion von Vorbringen nach privilegierter Antragsänderung BGH, Urteil vom 15. Dezember 2022 â I ZR 135/21 Der I. Zivilsenat befasst sich mit dem Verhältnis zwischen § 264, § 533 und § 531 Abs. 2 ZPO. Die ursprüngliche Klägerin nahm das beklagte Logistikunternehmen wegen Beschädigung von […]
OLG Frankfurt a. M.: Verzögerungsgebühr wegen Nichttragens einer Maske
| Dr. Frank O. Fischer Richter am Amtsgericht 27. Dezember 2022 – 13:24 |
Das OLG Frankfurt a. M. (Beschl. v. 27.9.2022 â 7 WF 116/22) hatte über die Verhängung einer Verzögerungsgebühr gem. § 32 FamGKG bei Zuwiderhandlung und Terminsvertagung zu entscheiden. Im Rahmen einer Sitzung des Familiengerichts ordnete der Richter am Amtsgericht an, dass die Beteiligten eine Maske zu tragen haben. Eine Rechtsanwältin war dazu nicht bereit. Der […]
Blog powered by Zöller: FuÃangeln beim beA
| Z̦ller-Autor Prof. Dr. Reinhard Greger 19. Dezember 2022 Р15:53 |
Sieht man von gelegentlichen technischen Pannen ab, hat sich die Ãbermittlung von Anwaltsschriftsätzen an die Gerichte über das besondere elektronische Anwaltspostfach gut eingespielt. Der Nutzer muss aber auch umsichtig mitspielen, so z.B. beim Signieren des Schriftstücks. Nach § 130a Abs. 3 Satz 1 ZPO genügt bei der Nutzung des beA die einfache Signatur, d.h. die […]
Montagsblog: Neues vom BGH
| Dr. Klaus Bacher Vorsitzender Richter am BGH 17. Dezember 2022 – 13:41 |
Diese Woche geht es um die Möglichkeit einer Erledigungserklärung nach Erfüllung der Forderung im Mahnverfahren. Erledigungserklärung nach Zahlung im Mahnverfahren BGH, Urteil vom 17. November 2022 â VII ZR 93/22 Der VII. Zivilsenat befasst sich mit den Möglichkeiten des Gläubigers, eine ihm günstige Kostenentscheidung zu erlangen, nachdem der Schuldner die geltend gemachte Forderung nach Zustellung eines Mahnbescheids erfüllt hat. […]
OLG Düsseldorf: Vorwegnahme der Hauptsache im einstweiligen Verfügungsverfahren
| Dr. Frank O. Fischer Richter am Amtsgericht 16. Dezember 2022 – 13:22 |
Es besteht Einigkeit darüber, dass im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens die Hauptsache nicht vorweggenommen werden soll. Zu den Ausnahmen von diesem Grundsatz sowie zu weiteren interessanten Fragen in diesem Zusammenhang hat sich das OLG Düsseldorf (Beschl. v. 20.10.2022 â 26 W 6/22) geäuÃert. Die Parteien sind durch einen Energielieferungs-Vertrag verbunden. Die Antragstellerin beantragt, die von […]
Montagsblog: Neues vom BGH
| Dr. Klaus Bacher Vorsitzender Richter am BGH 10. Dezember 2022 – 17:25 |
Diese Woche geht es um die Voraussetzungen einer Aussetzung des Verfahrens wegen Vorgreiflichkeit eines anderweit anhängigen Rechtsstreits. Vorgreiflichkeit bei Streit um vormerkungsgesicherten Anspruch BGH, Beschluss vom 22. September 2022 â V ZB 22/21 Der V. Zivilsenat befasst sich mit den Voraussetzungen des § 148 Abs. 1 ZPO und der Reichweite der Rechtskraft. Die Klägerin hat im Jahr 2018 ein Grundstück erworben. […]
Montagsblog: Neues vom BGH
| Dr. Klaus Bacher Vorsitzender Richter am BGH 3. Dezember 2022 – 17:00 |
Diese Woche geht es um den Anspruch eines rechtsschutzversicherten Mandanten gegen seinen Anwalt auf Ersatz angefallener Kosten wegen unzureichender Beratung. Kostenschaden auch bei Rechtsschutzversicherung BGH, Urteil vom 29. September 2022 â IX ZR 204/21 Der IX. Zivilsenat wendet die Grundsätze der Vorteilsausgleichung auf den Kostenschaden eines rechtschutzversicherten Mandanten an. Der beklagte Rechtsanwalt erwirkte im Jahr 2009 im Auftrag des […]
BGH: Notieren einer Vorfrist
| Dr. Frank O. Fischer Richter am Amtsgericht 1. Dezember 2022 – 14:58 |
Der BGH (Beschl. v. 20.09.2022 â VI ZB 17/22) hat sich im Rahmen der Ãberprüfung eines vom OLG zurückgewiesenen Wiedereinsetzungsantrages dazu geäuÃert, wann eine Vorfrist zu notieren ist. Eine ansonsten zuverlässige Angestellte der Rechtsanwältin hatte es versehentlich versäumt, das Ende der richtig berechneten Berufungsbegründungsfrist in den Fristenkalender einzutragen. Dies fiel leider erst nach Fristablauf auf. […]
Montagsblog: Neues vom BGH
| Dr. Klaus Bacher Vorsitzender Richter am BGH 27. November 2022 – 14:55 |
Diese Woche geht es um die Zulässigkeit eines Grundurteils und einer Zurückverweisung der Sache von der zweiten in die erste Instanz. Grundurteil und Zurückverweisung in der Berufungsinstanz BGH, Urteil vom 18. Oktober 2022 â XI ZR 606/20 Der XI. Zivilsenat formuliert grundlegende Anforderungen an die Prozessökonomie. Die Beklagte war in den 1990er Jahren mit dem Bruder des Klägers (nachfolgend: […]